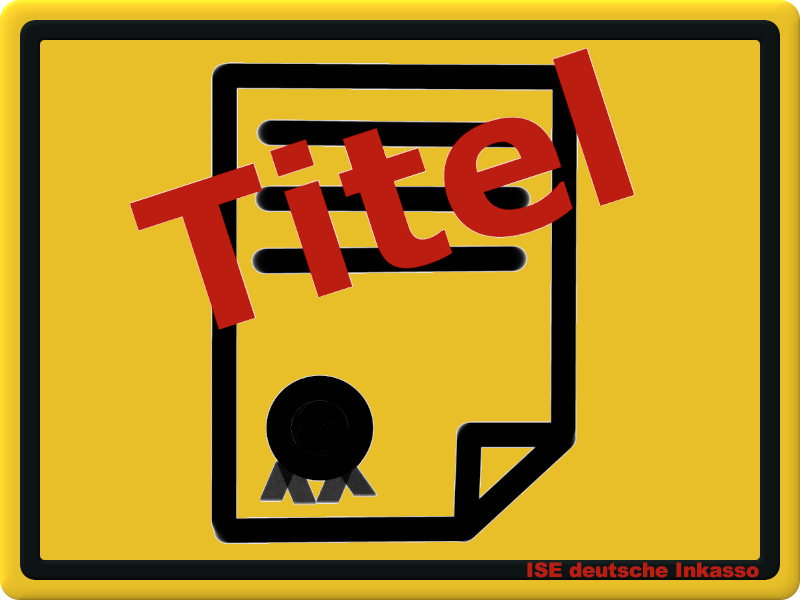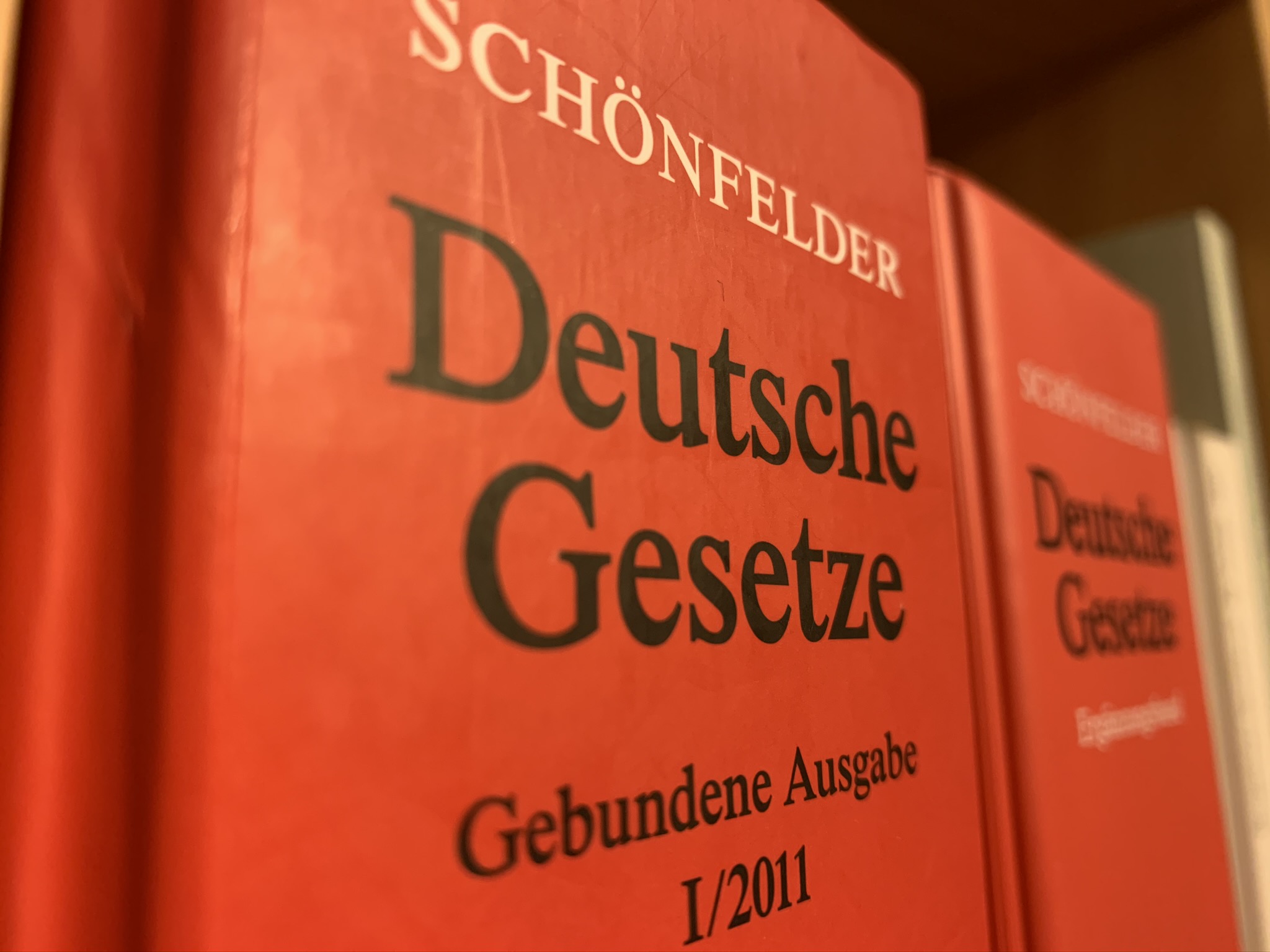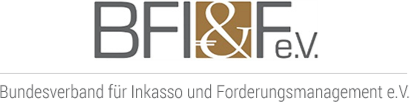Mit dem neuen Investitionssofortprogramm hat die Bundesregierung ein Steuerinstrument geschaffen, das für viele Unternehmer sofort spürbare Entlastung bringt: die beschleunigte Abschreibung (AfA). Statt Anschaffungskosten über viele Jahre linear verteilen zu müssen, können Maschinen, Fahrzeuge oder andere Wirtschaftsgüter jetzt deutlich schneller steuerlich geltend gemacht werden.
Das bedeutet: Schon im ersten Jahr nach einer Investition sinkt die Steuerlast erheblich. Das Finanzamt verzichtet gewissermaßen auf einen Teil seiner Ansprüche – und genau diese Liquidität bleibt im Unternehmen.
Ein Praxisbeispiel: Maschine statt Steuerlast
- Ein Handwerksbetrieb kauft im Juli 2025 eine neue Maschine für 50.000 €.
- Bei linearer Abschreibung von 10 % hätte er im ersten Jahr nur 5.000 € geltend machen können.
- Durch die neue degressive AfA sind es im ersten Jahr bis zu 30 %, also 15.000 €.
- Ergebnis: Die Steuerlast reduziert sich sofort um mehrere tausend Euro.
- Diese Liquidität steht sofort für andere Zahlungen bereit – etwa für Löhne, Lieferanten oder die Begleichung offener Rechnungen.
Warum das für Gläubiger entscheidend ist
Für Sie als Gläubiger bedeutet das: Ihre Schuldner haben durch diese Regelungen mehr Zahlungsmöglichkeiten. Das Finanzamt nimmt sich automatisch zurück – Sie müssen nicht warten.
- Mehr Liquidität: Schuldner können dank der Steuererleichterungen sofort mehr Mittel einsetzen, um offene Forderungen zu begleichen.
- Stärkeres Inkasso-Argument: In Mahnschreiben oder Gesprächen lässt sich darauf hinweisen:
„Nutzen Sie die steuerlichen Spielräume durch die neue AfA, um Ihre Lieferanten zügig zu bezahlen.“ - Verschobene Prioritäten: Während das Finanzamt durch Gesetz wartet, können Lieferantenforderungen aktiv eingefordert werden.
- Weniger Risiko: Gerade in Branchen mit hohen Investitionen (Handwerk, Logistik, Produktion) ist der Effekt deutlich – genau dort, wo auch viele Gläubigerforderungen offenstehen.
Kommunikations-Anker für Gläubiger
Wenn Sie Ihre Schuldner ansprechen, können Sie die steuerliche Entlastung ganz gezielt in Ihre Argumentation einbauen:
- Hinweis auf Sofort-Liquidität:
„Dank der neuen Abschreibungsregeln bleiben Ihrem Unternehmen in diesem Jahr tausende Euro mehr in der Kasse. Nutzen Sie diese Spielräume, um Ihre offenen Verbindlichkeiten sofort auszugleichen.“ - Vergleich mit dem Finanzamt:
„Das Finanzamt wartet durch die neue Regelung automatisch länger auf sein Geld. Ihre Lieferanten hingegen sind auf pünktliche Zahlungen angewiesen.“ - Fokus auf Geschäftsbeziehungen:
„Investitionen sichern Ihre Zukunft – aber nur verlässliche Geschäftsbeziehungen sichern Ihre Gegenwart. Zahlen Sie deshalb zuerst Ihre Lieferanten.“ - Liquidität als Vertrauensfaktor:
„Zeigen Sie, dass Ihr Unternehmen durch die steuerlichen Entlastungen gestärkt wurde, indem Sie alte Rechnungen bereinigen.“
Fazit: Ihre Chance als Gläubiger
Das Investitionssofortprogramm ist kein reines Steuerthema – es wirkt sich direkt auf die Zahlungsfähigkeit und Zahlungsmoral Ihrer Schuldner aus. Nutzen Sie diesen Moment:
- Verweisen Sie aktiv auf die neuen steuerlichen Spielräume.
- Machen Sie deutlich, dass Lieferanten und Partner nicht warten können.
- Setzen Sie den Hebel dort an, wo er am stärksten wirkt – bei der frischen Liquidität, die dank der neuen Abschreibungen entsteht.
Das Finanzamt soll warten. Sie als Gläubiger müssen Ihr Geld schneller bekommen.
Lassen Sie Ihr Geld nicht liegen, wenn das Finanzamt bereit ist zu warten.
Offene Forderungen belasten Ihre Liquidität und Ihre Geschäftsbeziehungen. Nutzen Sie jetzt die Spielräume Ihrer Schuldner – wir sorgen dafür, dass Ihre Ansprüche wieder an erster Stelle stehen.